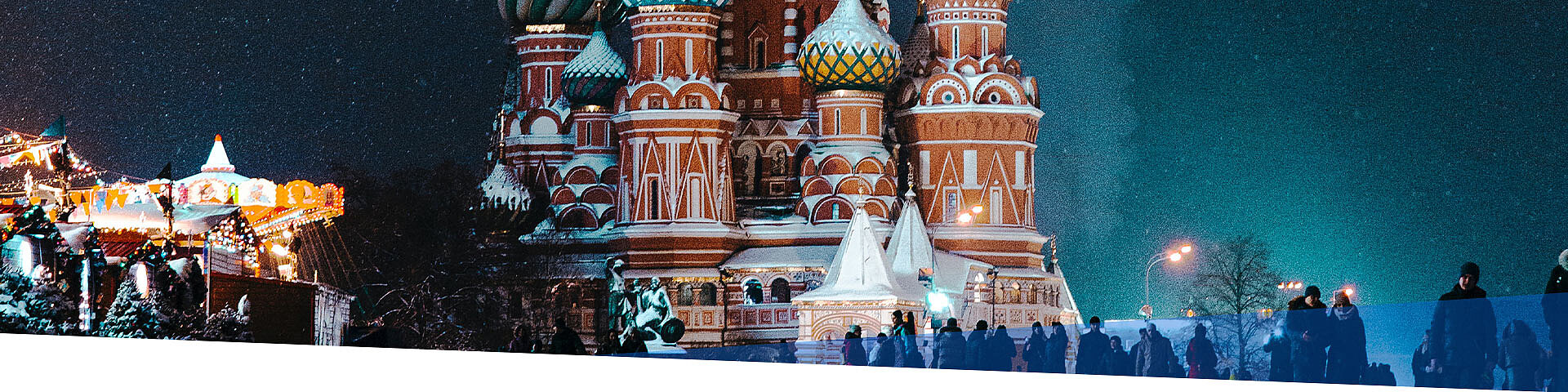Interview
Do Swidanja,
Leo Weschmann
30.05.2023
Als er Ende der Sechzigerjahre, mitten im Kalten Krieg, in seiner Heimatstadt Dülmen auf das Gymnasium kam, war Russland ein unerreichbarer Ort jenseits des Eisernen Vorhangs. Dennoch entstand in dieser Zeit in Leo Weschmann eine Leidenschaft für die russische Sprache und Kultur, die ihn schließlich bis ans Landesspracheninstitut führte. Hier unterrichtete er 33 Jahre lang Russisch, 2009 wurde er Institutsleiter des Russicums. Auf seinen beginnenden Ruhestand freut er sich, auch wenn klar ist: „Ganz ohne Abschiedsschmerz geht es nicht“.
Mit Dr. Leo Weschmann geht ein hochgeschätzter Kollege und Freund, der „Russischlehrer der Astronauten“, ein weit über das LSI hinaus anerkannter Fachmann, der es wie kaum ein Zweiter verstand, die komplexen Formen der russischen Sprache und Grammatik anschaulich und mit viel Liebe zum Detail zu vermitteln. Hinter ihm liegt ein abwechslungsreiches Berufsleben, in dessen Verlauf die wechselhaften deutsch-russischen Beziehungen eine wichtige Rolle gespielt haben, eine Geschichte von „Hoffnungen und enttäuschten Hoffnungen“, wie er sagt.
Leicht hat es ihm das Russische nicht gemacht. Von der anfänglichen Ablehnung der Eltern als Reaktion auf den Wunsch des 15-jährigen Russisch zu lernen, bis hin zu den schwierigen politischen Verhältnissen in Russland, die mit dem Angriff auf die Ukraine einen historischen Tiefpunkt erreicht haben. Trotz alledem: Die russische Sprache und Kultur, sagt Leo Weschmann, „ist etwas, das mich seit gut 50 Jahren begleitet und ein untrennbarer Teil meines Lebens ist. Das Interesse für Russland endet nicht mit dem Arbeitsleben.“

Lieber Leo, wenn Du über den bevorstehenden Ruhestand nachdenkst: Wie fühlt sich das für Dich an?
Ich freue mich darauf, aber es ist, umso näher es darauf zugeht, auch etwas zwiespältig. Ganz ohne Abschiedsschmerz geht es nicht. Das Russicum war von Anfang an mein Herzenskind. Es fällt schon schwer, das aus der Hand zu geben. Aber ich muss auch sagen: Die Freude darüber, welche Freiheit jetzt beginnt, überwiegt.
Du hast während Deiner Zeit am LSI viele personelle und inhaltliche Umbrüche miterlebt. Wo siehst Du die Kontinuität, was zeichnet das Russicum aus?
Der methodische rote Faden ist die Ausrichtung auf den Alltags-Sprachbedarf, auf situatives Sprechen, auf eigenständige sprachliche Handlungsmöglichkeiten. Nicht nur bei uns übrigens, das ist eine generelle Linie, die sich seit Ende der 70er-Jahren mit Abwandlungen überall durchgesetzt hat. Was wir im Gegensatz zu anderen beibehalten haben, ist die solide Vermittlung der russischen Grammatik. Russisch ist eine Sprache, in der die Grammatik aufgrund der Vielfalt der Strukturen kein Beiwerk, sondern so grundlegend wichtig ist, dass eine Kommunikation ohne Festigung grammatischer Strukturen nicht gelingen kann. In anderen Sprachen kommt man mit Wortschatz sehr weit, im Russischen ist das undenkbar. Da enden einfach sehr schnell die Ausdrucksmöglichkeiten.
Du hast 2009 die Leitung des Russicums übernommen. Wie würdest Du in der Rückschau deine persönliche Agenda beschreiben?
Der erste große Schritt war die Entwicklung des neuen Grundstufen-Lehrbuchs. Das alte Lehrwerk hat zu dieser Zeit die Alltagsrealität in Russland nicht mehr genügend widergespiegelt. Dann lag mir das Thema Auslandskurse sehr am Herzen. Zu Beginn und bis in die 1990er-Jahre hatten wir ausschließlich vierwöchige Intensivkurse, fünf Kursstufen insgesamt. Viele Teilnehmer haben in einem überschaubaren Zeitraum alle fünf Kurse absolviert und sind dann, durch uns organisiert, zu einem längeren Aufenthalt nach Moskau gegangen, entweder an das Puschkin-Institut oder an das sogenannte Eisenbahner-Institut. Zusätzlich hatten wir Auslandskurse in Simferopol auf der Krim. Unsere Lehrkräfte waren immer mit vor Ort. Um die Jahrtausendwende war das nicht mehr nötig. Russland hatte sich mittlerweile so weit geöffnet, dass die Teilnehmer eigenständig dorthin reisen und weiter Russisch lernen konnten. Unsere Kurse fanden danach fast nur noch in Bochum statt. Als Institutsleiter war es mir wichtig, die Auslandskurse wieder aufleben zu lassen, alte Kontakte zu erneuern, neue zu finden, sprachliche und kulturelle Brücken zu bauen. Das gelang ab 2010 schrittweise, zunächst mit einem neuen Kooperationspartner in Odessa, später auch in Moskau, St. Petersburg, zuletzt in Wologda und Tomsk, wo wir 2019 und 2020 noch erfolgreich Kurse durchgeführt haben, bevor die Pandemie und schließlich der Krieg dem ein vorläufiges Ende gesetzt haben.
Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine tendieren die Kontakte nach Russland jetzt wieder gegen null. Historisch gesehen gab es diese Situation schon einmal, seinerzeit im Kalten Krieg. Der Weg hinaus führte unter anderem über die Idee, sich einander über Sprache und Kultur anzunähern. War das in der Rückschau naiv?
Es war zumindest ganz sicher ein wichtiger Antriebsfaktor zur Gründung des Russicums. Nach Abschluss der Ostverträge war es Ziel der Politik, auch des damaligen NRW-Wissenschaftsministers Johannes Rau, den zukünftigen Slawistik-Studenten eine schnellere und bessere Russisch-Ausbildung zu ermöglichen und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, für ein Auslandssemester in die Sowjetunion zu gehen. Dabei spielte der Gedanke der Völkerverständigung eine Rolle, aber auch der Wunsch, eine Generation gut Russisch sprechender Studierender heranzubilden.
In Deiner persönlichen Biografie spielt das ebenfalls eine Rolle. Du hast ab 1976 Slawistik in Münster studiert. In Deiner Kindheit war es im Westen Deutschlands sicher nicht üblich, dass man Russisch sprach. Wie entstand Deine Begeisterung für die russische Sprache und wie wurde ein Beruf daraus?
Ich bin in Dülmen im Münsterland aufgewachsen, da sprachen sicher die wenigsten Russisch (lacht). Es gab dort zu der Zeit nur ein Gymnasium. Man lernte ab der fünften Klasse Englisch, ab der siebten Klasse Latein und konnte ab der neunten Klasse eine dritte Fremdsprache wählen, in der Regel Französisch. Durch Zufall gab es an unserer Schule einen Russischlehrer. Ich wollte unbedingt Russisch wählen, wie auch zwei meiner besten Freunde, aber meine Eltern waren strikt dagegen. Da spielten Erfahrungen aus dem zweiten Weltkrieg eine Rolle, mehrere meiner Onkel sind an der Ostfront umgekommen. Für meine Eltern gab es an Russland einfach nichts Positives. Ich habe erst mal Französisch gewählt, aber praktisch vom ersten Tag an mit meinen Freunden die Russisch-Hausaufgaben gemacht, so lange bis das zu Hause aufflog. Die Motivation war eine Mischung aus kindlicher Neugier und, mit damals 15 Jahren, Protesthaltung gegen die Entscheidung der Eltern.
Das Spannende daran ist, dass Du diese Leidenschaft, die später zu Deinem Beruf wurde, zuerst gegen Widerstände durchsetzen musstest.
Das hatte auch damit zu tun, dass meine Familie immer sehr anglophil gewesen ist, mit Verwandten in den USA und Freunden in der Nähe von London. Es gab einen regen Austausch. Ich bin, so lange ich denken kann, immer von englischer Sprache umgeben gewesen und habe später Anglistik als zweites Fach studiert. Als Jugendlicher habe ich an zwei Austauschprogrammen in Amerika teilgenommen. Ich habe immer gedacht, dass das auch in die andere Richtung, nach Osten, funktionieren muss. Das war ein starker Impuls, mich mit russischer Sprache und Kultur zu beschäftigen. Es hat mich von Anfang an gepackt: russische Literatur, zunächst noch in deutscher Übersetzung, russische Geschichte - ich habe alles gelesen, was ich bekommen konnte.
Gab es in der Sprache selbst etwas, das eine Resonanz in Dir ausgelöst hat?
Gute Frage. Meine Eltern bekamen irgendwann mit, dass ich mich trotz ihrer Ablehnung intensiv mit Russisch beschäftigt hatte. Schließlich bekam ich ihre Erlaubnis, Unterricht an der Volkshochschule zu nehmen. Ich bin in meinem Leben immer für das Fremdsprachenlernen begeistert gewesen. Was mich am Russischen wirklich zutiefst fasziniert, ist die komplexe grammatische Struktur der Sprache. Irgendwann bin ich an ein Bändchen mit Tschechow-Erzählungen gekommen und habe angefangen, die Geschichten im Original zu lesen, wobei ich anfangs jedes zweite Wort im Wörterbuch nachschlagen musste. Da wurde mir auch klar, dass mein Russisch noch nicht für ein Slawistik-Studium reichen würde. Diesen Plan hatte ich mittlerweile, kurz vor dem Abitur, gefasst. Die Uni Münster, an der ich 1976 anfing zu studieren, hatte zum Glück ein Sprach-Propädeutikum, jede Woche 20 Stunden Russischunterricht in den ersten beiden Semestern.
In Bezug auf das Fremdsprachenlernen fällt manchmal der Begriff der Bewusstseinserweiterung. Hast Du das auch so empfunden?
Ja, unbedingt. Ich glaube, dass jegliches Fremdsprachenlernen zu einer Bewusstseinsveränderung führt, durch die Sprache selbst, durch die Strukturen, die sich verankern müssen, aber auch durch die neue Kultur und die damit verbundenen Denkweisen. Im Russischen - ich will das nicht glorifizieren, dafür sind es absolut die falschen Zeiten - aber ich bin überzeugt, dass die sehr differenzierte Grammatik strukturiertes Denken fördert. Als ich durch das Studium tiefer in die Sprache hineinkam und schließlich selber in die Sowjetunion fuhr, hat sich mir ein Teil der Welt erschlossen, in dem die Lebensbedingungen, aber auch die Werte und Denkweisen der Menschen völlig anders waren.
Wann bist Du das erste Mal in Russland gewesen?
Das war gar nicht so einfach. Die Uni Münster hatte keine direkte Verbindung zu einer sowjetischen Universität. Es gelang mir aber schließlich 1982 mit einem Stipendium der deutsch-sowjetischen Freundschaftsgesellschaft für ein halbes Jahr nach Moskau ans Puschkin-Institut zu gehen. Das war die zentrale Anlaufstelle für Studierende aus aller Welt, die Russisch als Fremdsprache studierten. Der Unterricht war komplett auf Russisch, da brauchte man gute Vorkenntnisse. Mein Russisch hat sich in dieser Zeit enorm verbessert. Davor war ich 1979 mit einer studentischen Reisegruppe in der Sowjetunion, das war mein erster Aufenthalt in Russland. Es gab in Münster eine Organisation mit dem sehr bezeichnenden Namen Spontan e.V. (lacht). Mit denen habe ich meine erste Reise durch die Sowjetunion gemacht, mit dem Reisebus von Münster über Tallinn, Nowgorod und Moskau bis nach Kiew, dann über Belarus und Polen zurück nach Berlin. Drei Wochen, zwanzig Studierende, übernachtet haben wir auf Campingplätzen.
Das ist jetzt über 40 Jahre her, woran erinnerst Du dich?
Das ganze Alltagsleben dort sah komplett anders aus. Es gab kleine oder mittelgroße Läden für Lebensmittel, in denen man sehr lange anstehen musste. Alles wirkte etwas farblos und grau, so wie man es aus der ehemaligen DDR kennt. Die Menschen, russische Familien insbesondere, die auf den Campingplätzen Urlaub machten, waren sehr herzlich. Ich erinnere mich, dass wir gemeinsam Beeren gesammelt und Marmelade gekocht haben. Abends am Lagerfeuer wurde über Gott und die Welt geredet, da gab es keine Einschränkungen. Sicher gab es auch Spitzel und unsere Reispläne waren den Behörden bekannt. Es wurde kontrolliert, ob wir pünktlich abfuhren und ankamen. In Moskau mussten wir für einen Mitreisenden eine Zahnbürste kaufen, durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe. Nachdem wir im GUM, dem großen Kaufhaus am roten Platz, fündig geworden waren, laufen wir also quer über den roten Platz, wobei wir offenbar die erlaubten Wege nicht beachtet haben. Ein Polizist kommt und vertreibt uns. Der Kommilitone verliert seine Zahnbürste, will zurücklaufen und sie aufheben, wieder Polizei…wie im absurden Theater! Schließlich hat man uns ziehen lassen. Ich bin mir sicher, im heutigen Russland wären wir alle auf der Polizeiwache gelandet. Dass zu der Zeit schon Menschen in Lagern saßen, dass Intellektuelle wie Solschenizyn und andere ausgewiesen worden waren, das gehört in der Rückschau auch zum Bild dazu.
War Dir das damals bewusst? Das Ausmaß an Unterdrückung, mit dem der Staat gegen die eigene Bevölkerung vorging?
Ich wusste davon. Wenn ich das heute rückblickend betrachte, hätte es in dem Alter vielleicht schon ein reiferes Herangehen erfordert. Aber ich war so begeistert von den allermeisten Dingen, die ich dort erlebt habe, von den Leuten, die ich kennengelernt habe, dass ich das vielfach ausgeblendet habe.
Du bist, trotz Deiner großen Liebe zur russischen Sprache und Kultur, nie unkritisch gegenüber politischen Fehlentwicklungen in Russland gewesen. Wie hältst Du diese innere Spannung aus?
Das ist ein innerer Widerstreit, der viel mit Hoffnungen und zerstörten Hoffnungen zu tun hat. Als ich im Wendejahr 1990 anfing, hier zu arbeiten, hatten wir eine Rekordzahl an Kursteilnehmern. Sehr viele Deutsche, auch im Westen, waren nach Gorbatschow fasziniert von dem, was sich in Russland tat, von den Perspektiven, die sich auftaten. Viele Russen haben das übrigens ganz anders empfunden. In der Jelzin-Zeit gab es große materielle Not und enorme Unsicherheit in allen Bereichen der Gesellschaft. Trotzdem war der Schwung der neuen Zeit so groß, dass viele, auch ich, gedacht haben: Es geht in eine gute Richtung.
Würdest Du sagen, dass wir Deutschen uns im Überschwang der Wendezeit einen zu romantischen Blick auf Russland angewöhnt haben?
Ja, ganz sicher.
Durch den russischen Überfall auf die Ukraine ist das zu einer hochbrisanten Frage geworden. Auf politischer und gesellschaftlicher Ebene versucht man sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben, nach dem Motto: Das hätte man alles seit Jahren kommen sehen können. Wie beurteilst Du das?
Für mich hat das drei ganz unterschiedliche Argumentationsstränge. Die romantisierende Sicht der Deutschen auf Russland, auf die „russische Seele“, die Vorstellung von etwas geradezu Mystischem in der russischen Kultur, die reicht weit zurück. Das hat sich seit dem 19. Jahrhundert als eine Art geistesgeschichtlicher Hintergrund bei uns ausgebreitet. Die Wiedervereinigung hat noch einmal etwas Neues hineingebracht, insbesondere die Beziehungen zwischen Ostdeutschland und Russland. Die waren weniger romantisch verklärt, dafür umso konkreter, zum Beispiel in Form persönlicher Freundschaften oder auch durch Akademiker, die in der Sowjetunion studiert und das als Privileg empfunden haben. Der dritte Aspekt sind die politischen Entscheidungen, die jetzt häufig „Fehleinschätzungen“ genannt werden, im Grunde die gesamte westdeutsche Russlandpolitik bis zurück zu Willy Brandt und Egon Bahr. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Sichtweise. Man muss das aus der Zeit heraus sehen und interpretieren. Ich denke, dass die Hoffnung, auch in Bezug auf heute fraglich gewordene Konzepte wie „Wandel durch Handel“, kein Irrweg war. Natürlich kann man die aktuelle Situation aus der russischen Geschichte und der politischen Entwicklung im 20. und frühen 21. Jahrhunderts herleiten. Aber für mich ist Putin ein historischer Unfall. Das kann und wird nicht der dauerhafte Weg Russlands sein.
Die Beziehungen liegen auf Eis, sind aber nicht komplett zerstört?
Ich würde es vorsichtiger formulieren: Das Potenzial ist noch da. Die Herrschaft Putins wird irgendwann enden. Folgt dann ein ähnlich totalitäres Regime, das weiterhin für Europa und die Welt eine Bedrohung darstellt, hält die Abwanderung der andersdenkenden Russen weiter an und verbleibt im Land nur eine propagandistisch weitgehend verblendete Bevölkerung, dann driftet Russland ab. Es gibt noch Hoffnung, dass Russland diesen Weg nicht einschlagen wird und in das „europäische Haus“ zurückkehrt, aber der Ausgang ist leider völlig offen.
Welche Folgen hat das unter anderem für das Russische als Fremdsprache in Deutschland?
Ein negatives Image natürlich, nicht ganz zu Unrecht. Teil des anmaßenden und brutalen Vorgehens Russlands in der Ukraine ist ja eine vermeintliche kulturelle Überlegenheit, die sich auch am Thema Sprache festmacht. Nicht nur wird die Staatlichkeit der Ukraine infrage gestellt, sondern die gesamte ukrainische Sprache und Kultur wird als minderwertig abgetan. Das hat leider eine lange Tradition in Russland. Die Selbstbehauptung der ukrainischen Kultur gegen die russische Aggression ist deshalb ein ganz wichtiger Aspekt dieses Krieges.
Am LSI unterstützen wir das unter anderem dadurch, dass wir Ukrainisch in unser Kursprogramm aufgenommen haben. Dennoch halten wir natürlich weiter an Russisch fest. Warum?
Dass Russisch momentan, insbesondere von Ukrainerinnen und Ukrainern, als Sprache des Aggressors wahrgenommen wird, ist nachvollziehbar. Aber es ist eine Verengung der Sicht, die keinen Bestand haben kann. Man muss sich vor Augen führen, was für eine lange Tradition die russische Sprache hat. Es gibt enorm viele Menschen, auch außerhalb Russlands, die Russisch als ihre Muttersprache ansehen. In vielen Ländern Osteuropas und Zentralasiens ist es immer noch eine Art Lingua franca, ein Verständigungsmittel. Das mag weniger werden, wird aber nicht verschwinden. Man kann nicht aufgrund der verfehlten russischen Politik eine ganze Sprache und Kultur, die seit Jahrhunderten existiert, die wertvolle geistesgeschichtliche und kulturelle Beiträge zur Weltkultur geleistet hat, einfach verdammen.
Es hilft vielleicht der Gedanke, dass es mal Stimmen gegeben hat, die meinten, nach Auschwitz dürfe man kein Deutsch mehr sprechen…Es ist ja auch eine Behauptung, die von Putin immer wieder aufgemacht wird: Es sei eine Bewegung im Gange, deren Ziel es ist, die russische Sprache und Kultur zu zerstören. Dem sollte man nicht auf den Leim gehen, oder?
Natürlich nicht, das ist eine komplette Verdrehung der Tatsachen. Abgesehen davon ist es doch so: Es wird eine Zeit geben, in der wir uns ganz konkret mit russischen Menschen verständigen müssen. Ich freue mich, wenn mir junge Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, z.B. aus den Reihen der Studienstiftung sagen: „Gerade in diesen Zeiten müssen wir Russisch lernen. Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden und wir werden zwangsläufig weiter Nachbarn sein“. Das sind möglicherweise diejenigen, die in Zukunft politische Entscheidungen in Deutschland treffen und die Verhältnisse mitgestalten werden. Egal wie die weitere Entwicklung sein wird - ob aus unserer Sicht positiv oder negativ - wir werden kein langfristiges Zusammenleben in Europa erreichen, wenn es in Deutschland und in anderen Ländern in Europa keinen Menschen mehr gibt, der Russisch spricht und die russische Kultur tiefer versteht. Das ist eine zentrale Frage des zukünftigen, hoffentlich friedlichen, Zusammenlebens und vielleicht sogar des politischen Überlebens der Länder in Europa.
Deine letzte offizielle Mission für das LSI hat ein ähnlich gelagertes Ziel. Du leitest Ende des Monats einen Russischkurs für französische und deutsche Diplomaten in Riga.
Da geht es genau darum, vorhandene Russischkenntnisse auf hohem Niveau weiter auszubauen, um Kommunikation gerade in schwierigen Zeiten sicher zu stellen. Ziel ist unter anderem, Fertigkeiten im Bereich Rezeption verschiedenster Nachrichtenquellen, Podcasts etc. weiter zu entwickeln. Es gibt eine Vielzahl russischsprachiger Quellen, die ein sehr differenziertes Russlandbild liefern, auch abseits der staatlichen Propaganda. Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Sprachkompetenz der Teilnehmer auf ein Niveau zu bringen, das einen direkten Zugang zu diesen Informationen erlaubt. Die Hoffnung ist natürlich, dass irgendwann in der Zukunft wieder eine konstruktive Zusammenarbeit möglich wird. Diplomatie wird dabei eine wichtige Rolle spielen.
Ein Beispiel für eine über viele Jahre gute Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen, die bis heute noch nicht ganz zum Erliegen gekommen ist, ist die Raumfahrt. Das LSI hat auch dabei eine wichtige Funktion, da wir im Auftrag der ESA das Russischtraining für die Astronauten entwickeln und durchführen. Du hast den Prozess von Anfang an begleitet. Wie kam es dazu?
Das hat eine relativ lange Vorgeschichte. Die damalige neue Generation der europäischen Astronauten ab 2009, unter ihnen Alexander Gerst, haben ihrer Russischausbildung komplett hier am LSI gemacht, mit Etappen in St. Petersburg, Houston und im russischen „Sternenstädtchen“ Swjosdny Gorodok. Davor hat es bereits einzelnen Astronauten der älteren Generation bei uns gegeben, den Italiener Paolo Nespoli, den Holländer André Kuipers und den Deutschen Gerhard Thiele, die alle schon auf einem etwas besseren Niveau Russisch konnten, und die in der Zeit vor 2009 immer mal wieder zu Einzeltrainings bei uns waren. Die Arbeit mit den Astronauten war eine spannende und fordernde Aufgabe, die ungeheuer viel Freude gemacht und viele neue und wertvolle Erfahrungen mit sich gebracht hat.
Emotional trennst Dich nicht von Russland und der russischen Sprache? Du wirst auch im Ruhestand russische Literatur lesen, weiter Russisch sprechen?
Selbstverständlich! Das ist etwas, das mich seit gut 50 Jahren begleitet und das ein untrennbarer Teil meines Lebens ist. Das Interesse für Russland endet nicht mit dem Arbeitsleben.
Interview: Jörg Siegeler